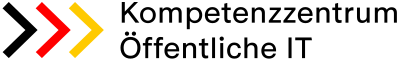Recht digital: Schwer verständlich »by Design« und allenfalls teilweise automatisierbar?
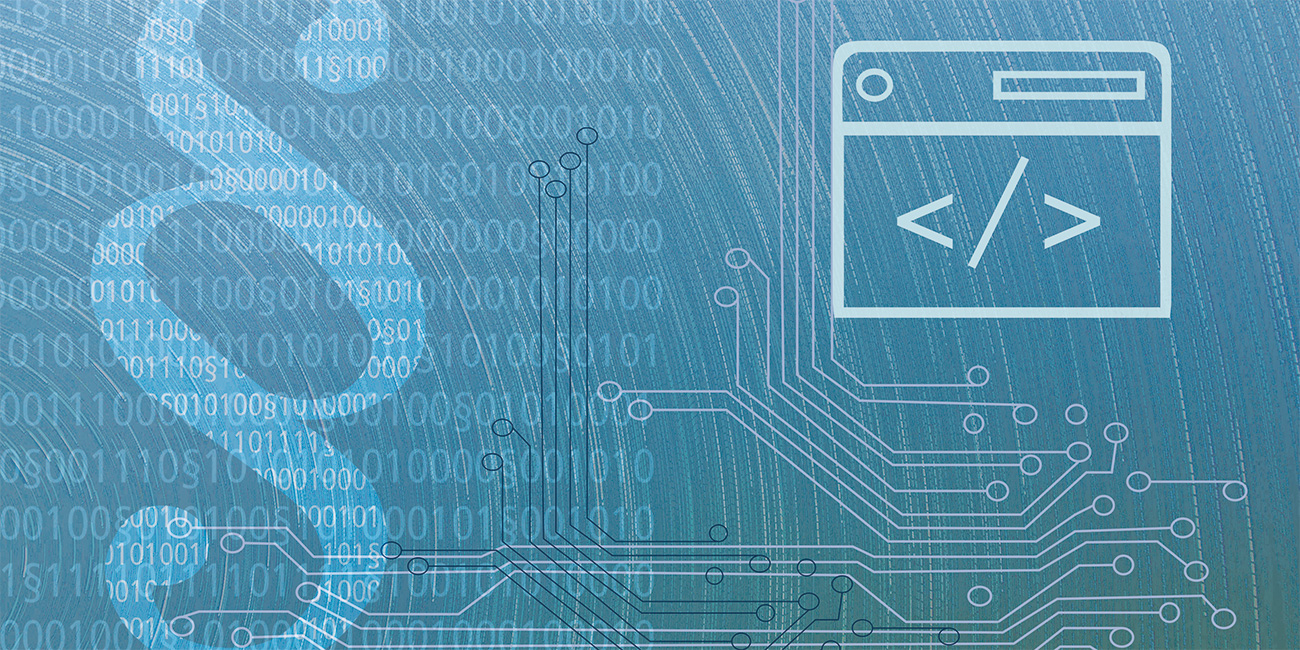
Recht digital: Schwer verständlich »by Design« und allenfalls teilweise automatisierbar?
von Carsten Berger und Michael Kolain
Carsten Berger ist Forschungsreferent im Programmbereich „Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung“ am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, wo er sich als Jurist und Verwaltungswissenschaftler mit Fragen der europäischen digitalen Souveränität beschäftigt. Er ist Promotionsstipendiat der Hanns-Seidler-Stiftung und Co-Host des außenpolitischen Podcast »Global Minds«.
Michael Kolain ist Forschungsreferent und Koordinator im Programmbereich »Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung« am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Regulierung neuer Technologien, die Digitalisierung der Verwaltung sowie rechtsinformatische Fragen. Er ist Mitglied im Expert Panel des European Blockchain Observatory & Forum und Vertreter des DIN-Verbraucherrats in der Blockchain-Standardisierung.
Wie kann zukünftig sichergestellt werden, dass Gesetze mit einem digitalen bzw. (teil)automatisierten Verwaltungsvollzugsprozess kompatibel sind? Hierfür muss der Hebel bereits bei der Entwurfsphase von Gesetzen und Verordnungen angesetzt werden. So lautete eine Kernaussage unseres Impulspapiers »Recht Digital«, in dem wir einige der Voraussetzungen dargestellt haben, die für automationstaugliche Rechtsnormen berücksichtigt werden sollten. Anknüpfend an dieses Papier möchten wir in einer Blogreihe das Themenfeld »Digitales Recht« explorativ in verschiedene Richtung weiter beleuchten.
Ein Überblick über die bisherigen Beiträge dieser Reihe:
- »Entlasten, nicht entmachten: Was der Gesetzgeber heute tun kann, um die Automatisierung der Öffentlichen Verwaltung zu unterstützen«
- »Modellieren statt programmieren: Low Code und die digitalisierte Körperschaftssteuer«
- »Better Rules«: Neuseelands Erfahrung mit digitalisierbarem Recht in der Corona-Krise
Michael Kolain und Carsten Berger werfen einen kritischen Blick auf das ÖFIT-Impulspapier »Recht Digital«. Sie zeigen auf, welche rechtswissenschaftlichen Hürden einer Umsetzung der Empfehlungen des Impulspapiers entgegenstehen.
Nachdem die Autoren des Papiers »Recht digital: Maschinenverständlich und automatisierbar« ihre Ergebnisse beim 9. Speyerer Forum zur digitalen Lebenswelt vorgestellt hatten, kam es zu einer intensiven Diskussion über den Vortrag bis tief in die Nacht. Im Anschluss baten uns die Kollegen am ÖFIT, unsere Perspektive zu ihren Überlegungen mitzuteilen – und damit gewissermaßen pars pro toto auch die mögliche Skepsis einiger Personen aus der Rechtswissenschaft an ihren Gedanken auf den Punkt zu bringen. Dem Wunsch kommen wir hiermit gerne nach und wollen dabei im Sinne einer gelebten konstruktiven Streitkultur so provokant sein, wie es auch das Impulspapier für sich beansprucht.
Die Tücken der Rechtssprache
Im Alltag kommen uns Worte so intuitiv, ja unbewusst über die Lippen, dass wir über all‘ ihre Verwendungsmöglichkeiten in der Regel nicht aktiv nachdenken. Um die unbedachte Dynamik und Paradoxie der (Rechts-)Sprache an einem Beispiel zu demonstrieren, beginnen wir mit der einfachen Frage: Gibt es in Deutschland Bundesländer?
Die spontane Antwort lautet wohl: Ja! Doch mit Blick auf die rechtssprachliche Präzision ist die Antwort so falsch, wie sie richtig ist.
- Warum ist die Antwort falsch?
Die Präambel des Grundgesetztes zählt die in Deutschland existierenden »Länder« (Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein etc.) auf. Im Verfassungstext selbst findet sich der Begriff »Länder« dann an über 100 weiteren Stellen. Der Begriff »Bundesland« fällt im Grundgesetz hingegen kein einziges Mal – obwohl Deutschland »ein demokratischer und sozialer Bundesstaat« ist (Art. 20 Abs. 1 GG). Sprachlich ist damit also klar: Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus Ländern besteht. »Bundesländer« gibt es hingegen in einer anderen deutschsprachigen Verfassung – und zwar in Österreich. In Art. 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes heißt es: »Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer«.
Wenn wir einer strengen Sprachlogik folgen, heißt das:
Wenn »Name« + »Bundesland» = Teil von Österreich
Wenn »Name« + »Land« = Teil von Deutschland
Logische Folge: das »Bundesland« Rheinland-Pfalz muss in Österreich liegen – was offensichtlich nicht stimmt. - Warum ist die Antwort richtig?
Weil wir uns an die Verwendung des Begriffs »Bundesland« gewöhnt haben und ihn (anders als eine Maschine) intuitiv in den passenden Kontext einordnen können. In Abgrenzung zum Begriff »Länder« ist »Bundesland« alltagssprachlich wohl sogar der klarere Begriff.
Beauftragte man nun aber einen Algorithmus, anhand der deutschsprachigen Verfassungstexte logisch zu eruieren, was ein Land ist, so würde er zum Ergebnis kommen, dass Deutschland in Länder untergliedert ist. Bundesländer würde er hingegen nicht finden, sondern dafür womöglich auf Österreich verweisen. Die strenge Logik der Maschine hätte zwar dem Sprachgebrauch der Verfassungsväter nach Recht, folgte damit aber nicht der (verständlichen) Alltagssprache.
Im Zivilrecht hat sich für Fälle, in denen die Parteien eines Vertrages zwar der Bezeichnung nach über das Falsche reden, aber inhaltlich das Gleiche meinen, die Lehre von der falsa demonstratio non nocet herausgebildet. Sie besagt, dass die falsche Bezeichnung nicht schadet, weil es auf den innerlich korrespondierenden Willen der Parteien ankommt und nicht auf das gesprochene Wort. Schließen ein Kunde und ein Weinhändler also etwa einen Kaufvertrag über »Pfälzer Weißherbst«, in der Annahme, dies sei ein Ausdruck für trockenen Weißwein, so kommt der Vertrag über den beidseitig gewollten Riesling zu Stande und nicht über den leckeren Rosé. Aber genug vom Pfälzer Wein und zurück zum Gedankenspiel der »(Bundes)Länder«.
Es zeigt sich also: Rechtsbegriffe müssen stets der Auslegung zugänglich sein und insbesondere den Zweck der konkreten Vorschrift bzw. des Gesetzes berücksichtigen, um die gewollte praktische Wirkung zu erzielen. Schon deshalb ist fraglich, ob sich den Bedürfnissen nach klaren Rechtsbegriffen ganz beiläufig durch »standardisierte Begriffsdefinitionen« Abhilfe schaffen, wie es die Autoren vorschlagen (S. 13 der Studie). Oder steckt dahinter eher der Versuch, eine komplexer werdende Welt in unterkomplexe Wikis zu packen? Als Rechtswissenschaftler würde es uns jedenfalls verwundern, wenn ein Standardisierungsprozess dazu in der Lage wäre, klarere Begriff zu finden und festzulegen, als es die jahrhundertelange Rechtsgeschichte in einem ständigen Ringen zwischen Gesetzgeber, Wissenschaft und Rechtsprechung hervorgebracht hat. Das heißt aber nicht, dass neue digitale Werkzeuge per se nicht zum Einsatz kommen sollten, um einzelne Begriffe für die gesetzgeberische Praxis zu konkretisieren und ungewollte Ambivalenzen in Rechtstexten zu vermeiden (so der Vorschlag der Autoren auf S. 13 der Studie).

Gesetze für Bürger, Verwaltung – und Juristen?
Die Studie »Recht digital« wirft eine grundlegende und spannende Frage auf: Für wen sind Gesetze eigentlich gemacht? Auf den ersten Blick scheint dies klar: Für die Bürgerinnen und Bürger, die sie befolgen (müssen)[1]. Doch Recht ist auch »Teil der juristischen Fachsprache«[2] – und gerade im »vollzugsrelevanten öffentlichen Recht« (S. 6 der Studie) ist ihr Adressat eben in erster Linie die Verwaltung. Es hängt deshalb also (auch) von der Gesetzesmaterie ab, »ob die Verständlichkeit von Gesetzen eine Bringschuld des Gesetzgebers oder eine Holschuld des Bürgers«[3] ist.
Liegt der Fokus auf dem Fachpublikum (etwa bei Normen, die der Verwaltung als Vollzugsanleitung dienen), so ließe sich argumentieren, dass von nun an eben nicht mehr – jedenfalls nicht mehr ausschließlich – Juristen das Fachpublikum sind, sondern (Verwaltungs-)Informatiker. Denn sie konzipieren und programmieren die softwarebasierten Prozesse einer digitalen Verwaltung. Durch »Vollzugsprozesse als Flussdiagramme« (S. 5 der Studie) wäre womöglich vielen Verwaltungsbediensteten klarer, welcher Schritt als nächstes zu erledigen ist, als bei verschachtelten Verwaltungsvorschriften. Man müsste sich nicht durch Papierberge voller Worte wühlen, um sich mühsam eine eigene Prozessskizze zu erstellen. Visualisierung ist in jedem Fall ein gutes Mittel, um komplexe Prozesse zu veranschaulichen und zu vereinfachen; sie sollte auch in der Rechtspraxis mehr Berücksichtigung finden.
Auch aus Sicht der Bürger ist es wichtig, nicht mit verschwurbeltem juristischem Fachjargon konfrontiert zu sein. So verpflichtet die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung öffentliche Stellen dazu, ihre online Auftritte auch in »Leichter Sprache« zugänglich zu machen. Doch lassen sich Gesetze und Verwaltungsprozesse zugleich in leicht verständliche Sprache und Programmcode fassen? Wären codebasierte Gesetze wirklich strukturierter als herkömmliche Rechtstexte? Der Versuch zu vereinfachen kann nicht zuletzt in sein Gegenteil umschlagen: Denn ein in Python geschriebenes Gesetz und in Wikis gepackte Verwaltungsabläufe sind dann gerade nicht mehr – jedenfalls noch weniger als herkömmliche Normtexte – für den Bürger oder den einzelnen Mitarbeiter verständlich, sondern können sich auch als unverständlich verschlängelter Code entpuppen. Schon deshalb wird es auch auf absehbare Zeit ein Nebeneinander codierter Details und allgemeinverständlicher Erläuterung geben müssen.
Gesetz aus Code oder codiertes Gesetz?
So spannend es auch ist, die Leitidee »Code is Law« in die Praxis zu tragen: Der Gesetzgeber verabschiedet Gesetze in menschlicher Sprache – nicht in Code. Da mehr Menschen des Deutschen als einer Programmiersprache mächtig sind, erhöht sich dadurch letztlich auch die Zahl derer, die Zugang zu einem Rechtstext haben.
Unterstellen wir aber einmal, die allgemeine Forderung der Autoren, dass »der Gesetzgeber Rechtsvorschriften auch in einem maschinenverständlichen Format veröffentlicht« (S. 5 der Studie) wäre Realität. Wie würde dann das Verhältnis des »geschriebenen« Gesetzes zum »codierten Gesetz« aussehen? Bleibt das geschriebene Gesetz stets das Original und sind die codierten Prozessabläufe die Übersetzung? Wie wäre mit Übersetzungsfehlern umzugehen bzw. die Übersetzung zu kontrollieren?[4]
Auf den ersten Blick klingt es verlockend, dem Primat des Codes zu folgen, der schnell und medienbruchfrei ein Ergebnis ausspuckt. Aber würde daraus in letzter Konsequenz nicht eine »algokratische« (A. Aneesh) Regierungsform entstehen, in der die Ebenen der Gesetzesformulierung und des Gesetzesvollzugs kaum mehr trennbar sind und in denen die Herrschaft des Code normabweichendes Verhalten im digitalen Raum nahezu unmöglich macht. Warum? Weil Governance-Modelle, in denen Algorithmen den Takt angeben, Freiheits- und Entscheidungsräume tendenziell beschränken und komplexe Sachverhalte tendenziell zu übersimplifizieren drohen. In einer algokratischen Verwaltung könnte dann ein »Recht zum Rechtsverstoß« sogar schnell zum Ausdruck von Menschlichkeit und Individualität avancieren. Denn ebenso wie ein demokratischer Staat nicht jede Verwaltungsnorm immer dem unbedingten Vollzug zuführen muss, ohne ihren Sinn und grundlegende Akzeptanz zu verlieren [5], so muss nicht jede Verwaltungsentscheidung wahrer sein, nur weil sie Ausfluss einer, streng am Recht orientieren, algorithmischen Entscheidung ist. Schon Josef K. gelangte zur Erkenntnis, dass stoische Gesetzesanwendung nicht immer der Weg zur Gerechtigkeit ist, als er feststellte: »Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht.«[6] So mutiert die Leitidee allzeit perfekten und gerechten Code is Law in der Verwaltungspraxis dann letztlich eher zu einem dystopischen Glauben an den iGod. Einen Gesslerhut braucht ein digitaler Rechtsstaat aber nun wirklich nicht.
Wie passt machinenverständliches Gesetz in das Konzept der Gewaltenteilung?
Eine zentrale Frage, ist aber auch, wie es um die checks and balances steht. In einem Rechtsstaat sind es die Gerichte, denen die die Deutungs- und Auslegungshoheit über das Verwaltungshandeln zukommt. Bedeutet das bei maschinenverständlichen Gesetzen, dass die judikative Kontrolle nicht mehr anhand der geschriebenen Norm erfolgt, sondern anhand der richtigen Umsetzung des Codes durch die Maschine? Braucht ein Richter ohne Informatikstudium dann stets einen Sachverständigen, um zu einem Urteil zu gelangen – oder sollten direkt die Informatiker den Richterstuhl besteigen? Was würde am Ende gar das Bundesverfassungsgericht in einem Normenkontrollverfahren prüfen, wenn das Parlament künftig Codes verabschieden würde? Reduzierte sich seine Aufgabe auf eine Art De-Bugging der Programmzeilen – oder könnte der Code nur noch auf seine richtige Umsetzung hin überprüft werden (Interpretamente)[7]?
Wenn man den Autoren der Studie neben all ihren innovativen Ideen eine Fundamentalkritik entgegenwerfen möchte, dann folgende: Sie verengen das weite Thema des »digitalen Rechts« auf die Perspektive der Staatsleitung und Exekutive. Die Legislative nehmen sie hingegen – womöglich bewusst – zu wenig in den Blick. In ihrer Begeisterung für effizienten Vollzug und automatisierte Prozesse lassen sie außer Acht, dass es gerade die Gewaltenteilung ist, die ein demokratisches Gemeinwesen stark macht – und dass es der Diskurs und der Dissens sind, die normative Aussagen gestalten, präzisieren, aber mitunter auch verwässern.
In der Logik des Rechtsstaats entstehen Gesetze im Parlament und sind Ausdruck eines aufwändigen Interessenausgleichs und oftmals Ergebnis komplexer politischer Kompromisse. In der Praxis sind es aber allzu oft die ministerialen Verwaltungen, die Gesetzesvorlagen schreiben und ihre Expertise einweben, bevor es im Parlament zur Abstimmung über ein Gesetz kommt. Genau auf diesen »Konzeptions- und Entwurfsprozess (…) von Rechtsvorschriften« zielen auch die Autoren der Studie (S. 17) und machen sinnvolle Vorschläge.
Die spannendere Frage ist aber, was eigentlich passiert, wenn ministeriell vorformulierte »eindeutige Entscheidungsregeln, Begriffsdefinitionen und Datenverknüpfungen« (S. 17 der Studie) ihren Weg ins Parlament finden: Müsste der Codeentwurf dann nach jeder Ausschusssitzung, Expertenanhörung und nach jedem Kompromiss im Vermittlungsausschuss neu geschrieben werden? Lässt ein politischer Kompromiss die wohldurchdachte Architektur des perfekten Verwaltungsprozesses schnell in sich zusammenfallen, wenn sich einzelne Bauteile verschieben? All das sind Folgefragen, die es zu beantworten gilt, bevor man damit beginnt, Gesetze in maschinenlesbare Form zu gießen.

Amtsermittlung in automatisierten Verwaltungsverfahren
Der Wunsch nach einer »automatisierte[n] Ausführbarkeit einer Norm« (S. 11 der Studie) verkennt zudem ein zentrales Problem der Rechtsanwendung – jedenfalls sofern sie unreflektiert davon ausgeht, dass eine »standardisierte […] Erfassung des Lebenssachverhalts« durch »Formulare […], die komplexe Lebenssachverhalte formalisieren« (S. 8 der Studie) einfach so möglich sei. Die Komplexität des Lebens lässt sich nur schwerlich in mathematische Formeln übersetzen. Selbst wenn es gelingt, die Norm in den Code zu bringen – wie kommt der zu entscheidende Lebenssachverhalt in die Entscheidungssoftware? Diese Übersetzungsleistung ist bei genauerem Hinsehen die eigentliche Herausforderung einer digitalisierten Rechtsanwendung. Hintergrund ist die behördliche Amtsermittlung (§24 VwVfG): Sie versagt es der Verwaltung, alle relevanten Informationen und Daten durch Eingabemasken vom Bürger abzufragen und darauf zu vertrauen, dass damit alle wesentlichen Tatsachen vorliegen, um eine Entscheidung zu treffen. Das Gesetz gibt vielmehr vor, dass die Verwaltung »an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten […] nicht gebunden« ist und »alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen« hat (§24 Abs. 1, 2 VwVfG). Eine rechtsstaatliche Verwaltung ist deshalb stets dazu aufgerufen, den wahren Umständen des Einzelfalls auf die Schliche zu kommen. Der kritische prüfende Blick eines Menschen ist dafür in vielen Fällen unerlässlich.
Hoch gesprungen, sanft gelandet
Mit dem Impulspapier »Recht digital: Maschinenverständlich und automatisierbar« legen die Autoren einerseits den Finger in eine offene Wunde: Sie fordern Gesetzgebung und Verwaltung dazu auf, sich selbst zu hinterfragen und ihrem gesetzlichen Auftrag, Staatsmacht zum Wohle der Bevölkerung auszuüben, möglichst effektiv und für den Bürger verständlich nachzukommen. Dadurch liefern sie wichtige Denkanstöße und artikulieren eine sinnvolle Kritik an dem teilweise durchaus überhöhten Selbstbild der Rechtswissenschaft und ihrer – oftmals nur scheinbar – passgenau ausgetüftelten Dogmatik und Vollzugslogik. Die Autoren erkennen das Problem, dass der Rechtsdiskurs schnell zu einem Elitendiskurs mutieren kann, der über dem Alltäglichen schwebt und die Vollzugsrealität in den Amtsstuben und die praktischen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger übersieht. Die Lösung kann es aber freilich nicht sein, die »Eliten der Automation« (Klaus Bednarik) an ihre Stelle zu setzen. Wenn es das Anliegen der Autoren ist, die fachwissenschaftlich-juristische Deutungshoheit über zentrale Entscheidungen des demokratischen Gemeinwesens zu hinterfragen, öffnet sich ein Raum für spannende Diskussionen. Aus dieser Perspektive pochen die Autoren nachvollziehbar darauf, dass ein rationaler und interdisziplinärer Umgang mit staatlicher Entscheidungsmacht in Zeiten der Digitalisierung dringend nötig ist. Der Staat braucht in der Tat neue Ideen, Methoden und Formen der fach- und ressortübergreifenden Kollaboration. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele Verwaltungsprozesse sperrig und unklar strukturiert sind.
So sehr die Autoren aber in die richtige Kerbe schlagen, so sehr drohen sie in Teilen dem technikromantischen Bild einer »Verwaltungsmaschine« zu erliegen, der man Gesetzgebung einprogrammiert, damit diese am Ende eine einzelfallgerechte Entscheidung ausspuckt. Dabei blenden sie nicht nur – wie erwähnt – die komplexen Verfahren der Gewaltenteilung ein Stück weit aus, sondern sie erheben tendenziell auch die Ausnahme der Verwaltungsentscheidungsrealität zur Regel. Dadurch erwecken sie einen verzerrten Eindruck. Sicher: Digitales Recht ergibt dort Sinn, wo auch die Umsetzung eines normativ vorgezeichneten Szenarios digital oder nach numerischen Vorgaben abläuft. Das sind Bereiche wie das Steuer- oder Sozialrecht, in denen die Verwaltung in Massenverfahren viele statische, ja algorithmische Normbestandteile abarbeitet. Die Grenze der Automatisierung ist aber dort erreicht, wo unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensnormen die Verwaltung zum Nachdenken und Nachforschen in jedem Einzelfall aufrufen. Mögen quantitativ Steuer- und Sozialhilfebescheide die Masse an Verwaltungsentscheidungen sein, so ist jedenfalls qualitativ die Ermessensentscheidung des Einzelfalls die Regel, die gerade nicht vollautomatisierbar ist bzw. sein darf (§35a VwVfG). Freilich: in der Verwaltungspraxis erfolgen viele Ermessensentscheidungen auch pauschal und ohne die notwendige Aufmerksamkeit für Details des Einzelfalls. Es ist jedoch nichts gewonnen, wenn der unmotivierten Sachbearbeiter durch Algorithmen mit Scheuklappen ersetzt wird.
In jedem Fall wäre spannend, auszuloten, wie viele »automatisierungsgeeignetes« Verwaltungsrecht es eigentlich gibt, um zu klären in welchen Verwaltungsbereichen »vollständige Automatisierung aller Prozessabläufe und Entscheidungen eines Verwaltungsverfahrens« (S. 9 der Studie) überhaupt Entscheidungen schneller und besser machen können. Hier ist die aktuelle Debatte tendenziell noch zu sehr von subjektiven Einschätzungen und zu wenig von empirischen Erkenntnissen geprägt.
Überzeugend ist auch der Vorschlag der Autoren, dass »interdisziplinäre Gesetzgebungsteams«, bei der »Ko-Produktion von Gesetzesentwürfen« (S. 16 der Studie) mit Design-Thinking-Ansätzen den perfekten Vollzugsprozess durchdenken. Die Idee interdisziplinärer Innovationseinheiten ist nicht nur en vogue, sondern kann die Arbeit in Ministerien verbessern. Doch bei allem Mut zur Innovation: Den demokratischen Diskurs können interdisziplinär planende Abteilungen in Ministerien nicht ersetzen – und weite Teile des Rechts werden auch auf absehbare Zukunft nicht in einfache Programmzeilen übersetzbar sein. Jedenfalls nicht ohne groß angelegte Forschungsprojekte, die sich dem großen Problem »digitalen Rechts« Schritt für Schritt annähern. Die Rechtsinformatik steckt hier nach unserer Einschätzung aber eher noch in den Kinderschuhen fest und muss noch zahlreiche Schritte in der Grundlagenforschung bewältigen, bevor operationalisierbare Ergebnisse zu erwarten sind.
Die Verwaltung ist schließlich keine Maschine, die man einmal richtig programmiert, und die dann wie am Schnürchen läuft. Sie ist und bleibt das »menschliche Antlitz des Staates«[8], braucht dafür Flexibilität und zielt stets auf Einzelfallgerechtigkeit. Mathematik löst Gleichungen, aber keine (zwischen)menschlichen Konflikte. Bei aller – nicht zuletzt erbetenen – Kritik: Als junge und am gesellschaftlichen Fortschritt orientierte Juristen wollen wir den Kollegen am ÖFIT nicht mit dem erhobenen Zeigefinger der Rechtswissenschaft begegnen, sondern ihnen die Hand der Interdisziplinarität reichen. Wir freuen uns auf viele weitere konstruktive und spannende Debatten!
[1] Deswegen schreibt sich die Bundesregierung auch selbst gemäß §42 Abs. 5 S. 1 GGO vor, dass Gesetzesvorlagen »sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich gefasst sein« müssen. ↩
[2] BMJV, Handbuch der Rechtsförmlichkeit Teil B Rn. 56. ↩
[3] Seckelmann, Leichte Sprache und Algorithmisierung als Anforderung an die Gesetzessprache, in: Rudolf Fisch (Hrsg.), Verständliche Verwaltungskommunikation in Zeiten der Digitalisierung, 2020, S. 158. ↩
[4] Reimer bringt etwa Überlegungen aus dem Völkerrecht von mehrsprachigen Verträgen ins Spiel, Reimer, Rechtssprache als Kulturgut, in: HFSt 10, S. 29 f. ↩
[5] Gängiges Beispiel ist gemeinhin, die rote Ampel. Dass der Staat es vielfach nicht ahndet, wenn Autofahrer oder Fußgänger eine rote Ampel überqueren, rüttelt per se noch nicht an dem Sinn und der grundsätzlichen Akzeptanz von Ampeln. Ein modernes Beispiel ist auch der Datenschutz, der insbesondere gegenüber großen Unternehmen durchgesetzt wird, obwohl er für alle gleichermaßen gilt, vgl. Rademacher, Wenn neue Technologien altes Recht durchsetzen: Dürfen wir es unmöglich machen, rechtswidrig zu handeln?, JZ 2019, 702, 710. ↩
[6] Kafka, Der Prozess. ↩
[7] Vgl. Reimer, Rechtssprache als Kulturgut, in: HFSt 10, S. 30 ff. ↩
[8] Martini, Digitalisierung der Verwaltung, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Band I, Heidelberg 2021 (im Erscheinen), Rn. 3. ↩
Veröffentlicht: 15.02.2021